In der letzten Zeit sind u.a. diese frei verfügbaren Titel erschienen:
Auf dem Weg zur Leseschule: Entwicklung, Erprobung und Evaluation schulspezifischer Konzepte zur nachhaltigen Implementation eines Leseförderprogramms

Marion Bönnighausen & Katharina Lammers
https://doi.org/10.3262/978-3-7799-8466-5
Transfers von innovativen Programmen aus der Universität in das System Schule bringen große Herausforderungen mit sich, die in diesem Band empirisch fundiert vorgestellt werden. Im Zentrum steht mit der Leseschule NRW ein systematisches Programm der Leseförderung, dessen Adaption an zehn Schulen im Primar- und Sekundarbereich über einen Zeitraum von sechs Jahren umfassend evaluiert wurde. Die Studie bietet einen detaillierten Einblick in Gelingensbedingungen eines Implementationsprozesses und stellt Good-Practice-Modelle vor, die anhand von Fallanalysen konkretisiert werden.
Diaristik im digitalen Zeitalter: Eine narratologische Gegenüberstellung von Tagebüchern und Blogs
Theresa Schmidtke
https://doi.org/10.17879/68938606191
Die deutschsprachige Literatur der Gegenwart steht der Digitalität betont skeptisch gegenüber. Gedruckte Bücher beherrschen den Markt und bestimmen den Diskurs. Originär digitale Texte werden oft sogar in analoge umgewandelt, sie werden ‚analogisiert‘. Was aber geschieht im Zuge dieses Prozesses mit ihren narrativen Eigenschaften?
Die Kernfrage dieser Arbeit lautet deshalb: Unter welchen Bedingungen ist es möglich, eine digitale Geschichte in einem analogen Buch zu erzählen? Die Untersuchungen gehen davon aus, dass es ein analoges und ein digitales Erzählen gibt. Allerdings muss digitales Erzählen nicht zwingend in einem digitalen Medienformat stattfinden und umgekehrt analoges Erzählen nicht in einem analogen Medienformat. Es könnte also sein, dass die analoge Gegenwartsliteratur erzählerisch digitaler ist, als es medial den Anschein macht.
Um dies zu zeigen, dienen Blogs und Tagebücher von SchriftstellerInnen als beispielhafter Untersuchungsgegenstand.
Die Dissertation ist am Münsteraner Germanistischen Institut entstanden; Betreuerin war Claudia Lieb.
Literarästhetisches Lernen im Ausstellungsraum: Literaturausstellungen als außerschulische Lernorte für den Literaturunterricht

Sebastian Bernhardt
https://doi.org/10.14361/9783839465035
Literaturausstellungen bieten zahlreiche Perspektiven für literarästhetische Erfahrungen im Raum. Literatur wird dabei nicht auf ihre Trägermedien reduziert, sondern als immaterieller Gegenstand betrachtet. Diesem Ansatz folgend untersucht Sebastian Bernhardt die didaktischen Potenziale von Ausstellungen, die Literatur mittels Szenografie in den Raum übertragen. Neben einer Systematisierung der Möglichkeiten solcher Übertragungen erschließt er die sich daraus für eine mediale Erweiterung des Literatur- und Medienunterrichts ergebenden Potenziale. Damit liefert er spezifische Einsichten in die genuin literarästhetischen Erfahrungen im Ausstellungsraum.
Rhetoriken zwischen Recht und Literatur: Interdisziplinäre und interkulturelle Zugänge
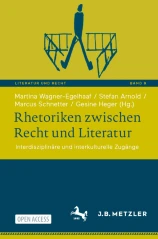
Martina Wagner-Egelhaaf, Stefan Arnold, Marcus Schnetter, Gesine Heger (Hrsg.)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66928-0
Die Beiträge dieses Open-Access-Buchs diskutieren das Verständnis von Rhetorik, mit dem heute in Literatur- und Rechtswissenschaft gearbeitet wird. Sie beleuchten, inwiefern sich die westliche Tradition von rhetorischen Perspektiven aus anderen Sprach-, Kultur- und Rechtsräumen unterscheidet. Während die Rhetorik in antiker Tradition in der Literaturtheorie nach wie vor eine große Rolle spielt, hat sie ihren Status als Leitdisziplin in den Rechtswissenschaften eingebüßt und ist lediglich für Teilbereiche wie Argumentationstheorie und Rechtslogik relevant. Der Band nimmt Recht und Literatur in ihrer gemeinsamen sprachlichen Konstitution ernst und fragt nicht zuletzt nach einem geteilten Grundverständnis von Rhetorik.

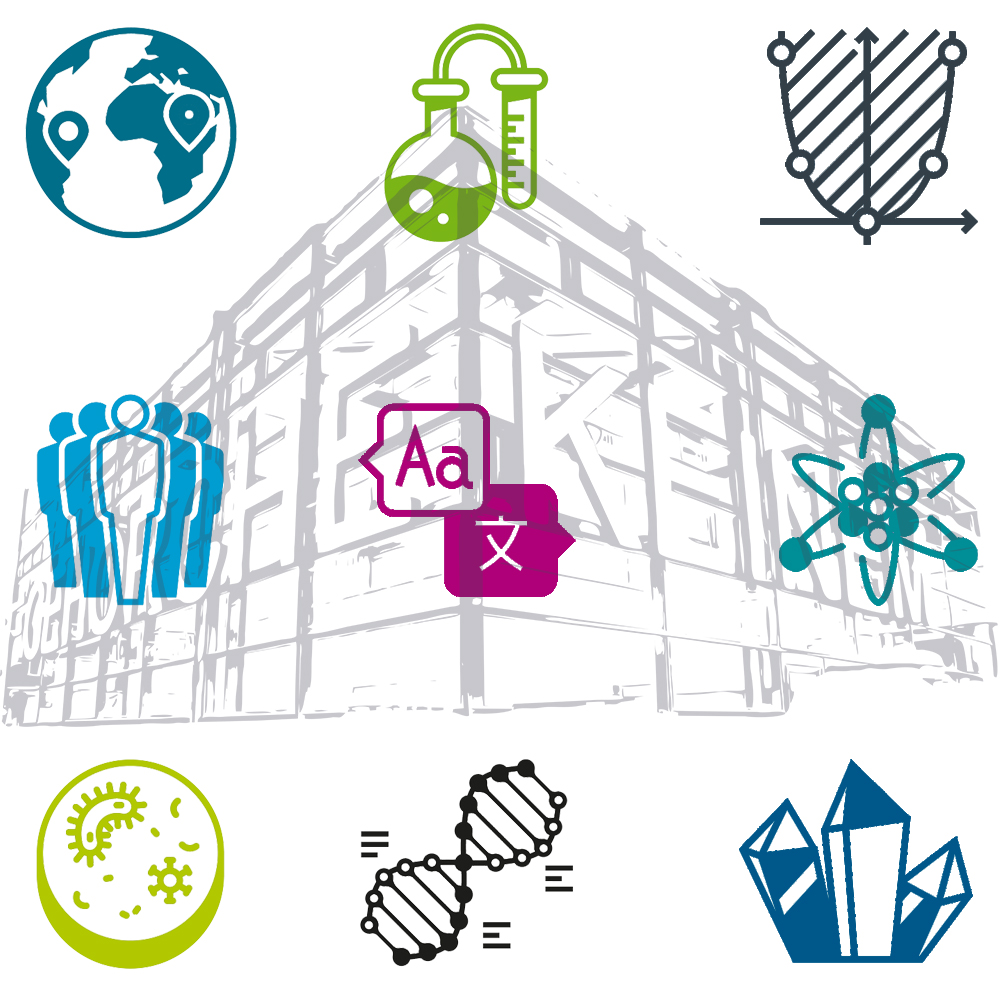
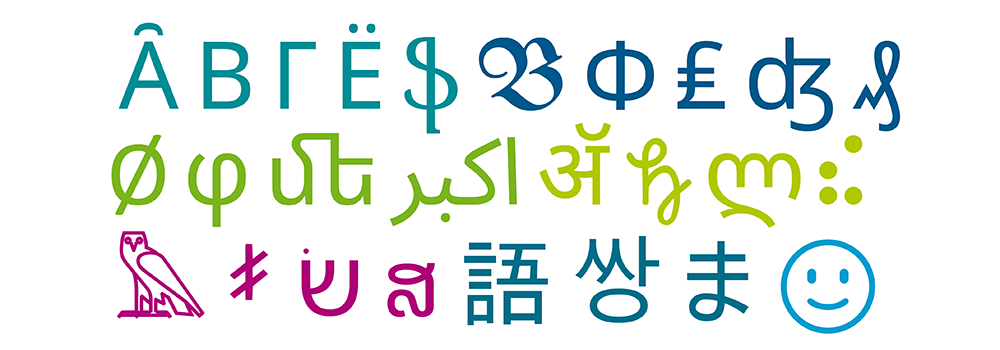

Schreibe einen Kommentar