WDR ZeitZeichen zu Ingeborg Bachmann
„Ingeborg Bachmann kann in einem Augenblick hässlich sein, und im nächsten eine bezaubernde Fee. So erinnert sich der Autor Peter Bichsel an seine Kollegin. Vor allem aber hält er fest, dass Bachmann „eine ganz große Schriftstellerin“ gewesen sei.
Tatsächlich hat Bachmann die deutsche Nachkriegsliteratur mit Erzählungen und Romanen wie „Das dreißigste Jahr“ (1961), „Malina“ (1971) und „Der Fall Franza“ (1978), aber auch mit Hörspielen wie „Der gute Gott von Manhattan“ (1958) und vor allem mit ihrer Lyrik maßgeblich geprägt.
Nationalsozialismus und Vielvölkerstaat
Geboren wird Bachmann als Tochter eines Volksschullehrers am 25. Juni 1926 in Klagenfurt. Der Vater tritt früh in die NSDAP ein, rückblickend wird die Autorin den „Schmerz“ beim Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt als Anfang ihrer Erinnerung und als biographischen Auslöser ihres Schreibens deklarieren.
Einen vielsprachigen Gegenentwurf findet Bachmann im Kärntner Gailtal im Dreiländereck Österreich-Italien-Slowenien, in dem sie einen Gutteil ihrer Kindheit verbringt. Der Nationalsozialismus und seine mangelhafte Aufbereitung in der Nachkriegszeit wird ebenso ein Pol ihrer Literatur wie die Utopie eines gewaltfreien Miteinanders der Völker.
Erklär mir, Liebe
Nach ihrem Studium Philosophie, Psychologie, Germanistik und Jurisprudenz in Graz, Wien und Innsbruck promoviert Bachmann 1950 mit einer kritischen Arbeit über Martin Heidegger und lebt danach in Paris, London, Rom, Berlin, München und Zürich. Da ist sie bereits dem Dichter Paul Celan begegnet, mit dem sie ab 1948 eine ebenso leidenschaftliche wie verzweifelte, von langen Zeiten der Trennung unterbrochene Liebe verbindet.
1964 wird Bachmann der Büchner-Preis zuerkannt. Ein Jahr nach Celans Freitod 1970 setzt sie ihm in ihrem Roman „Malina“ in Gestalt der geheimnisvollen, märchenhaft-überzeitlichen Figur eines Fremden im schwarzen Mantel ein Denkmal.
Thematisch geht es in dem Roman um die Unmöglichkeit der von gegenseitigem Missverständnis geprägten Liebe zwischen Mann und Frau und um die Rolle des Weiblichen in einer patriarchalischen Welt, autobiografisch aber wohl auch um Bachmanns Beziehung zu Max Frisch, in der beide letztendlich an den Anforderungen des jeweils anderen scheitern.
Die brennende Zigarette
Die von Frisch initiierte Trennung 1962 führt bei Bachmann zu psychischen Problemen: Medikamente, Drogen, Alkohol und Klinikaufenthalte sind die Folge. Halbwegs stabilisiert zieht die Autorin 1965 wieder nach Rom, wo sie sich zu Hause fühlt.
In einer Septembernacht 1973 schläft sie im Bett mit einer brennenden Zigarette ein. Sie stirbt kurz darauf im Alter von 47 Jahren an den Folgen ihrer Brandverletzungen in einer Klinik in Rom.“
(WDR, Monika Buschey, Redaktion: Gesa Rünker)
Sie können die Sendung, die am 25.6.2021 in der Reihe „ZeitZeichen“ lief, über die Seite des WDR nachhören oder als Audiodatei herunterladen.
Bayern2 radioWissen: „Ingeborg Bachmann – Die traurige Dichterin“
 „Ingeborg Bachmann, nach der ein bedeutender Literaturpreis benannt ist, liebte die Musik und die Philosophie, war die Intellektuelle par excellence, glänzte im Kreis der Gruppe 47. Nur glücklich war die überaus Talentierte selten.“ (Bayern 2, Gabriele Knetsch)
„Ingeborg Bachmann, nach der ein bedeutender Literaturpreis benannt ist, liebte die Musik und die Philosophie, war die Intellektuelle par excellence, glänzte im Kreis der Gruppe 47. Nur glücklich war die überaus Talentierte selten.“ (Bayern 2, Gabriele Knetsch)
Sie können die Sendung aus dem Jahr 2018, die zuletzt am 7.11.2023 auf Bayern 2 lief, über die Seite des BR nachhören oder als Audiodatei herunterladen.

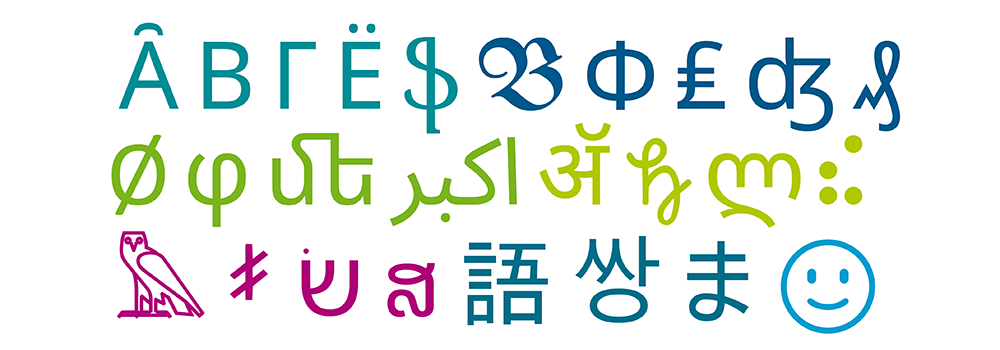

Schreibe einen Kommentar